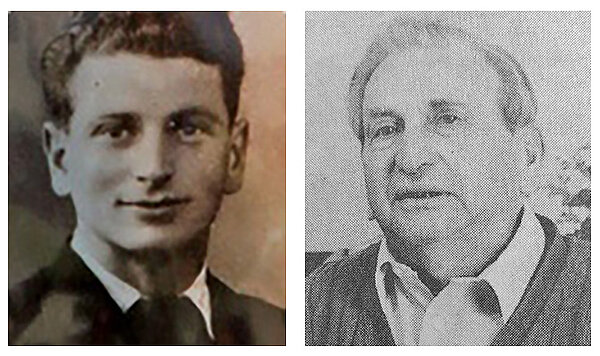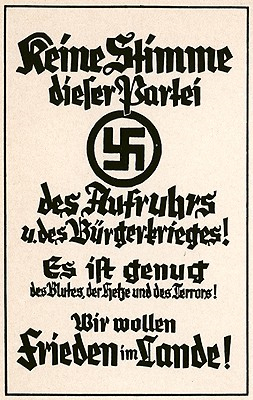Blick in die Geschichte Nr. 122
vom 22. März 2019
Widerstand gegen den Nationalsozialismus
Menschen aus Karlsruhe in der Résistance
von Brigitte und Gerhard Brändle
"Aus den Augen, aus dem Sinn" - so ungefähr steht es um die Wahrnehmung der Menschen aus Karlsruhe, die ihre Heimat verlassen mussten und in Frankreich Widerstand gegen die Nazi-Besatzer leisteten. Sie mussten weg aus Karlsruhe, sei es, dass sie als Juden bedroht, sei es, dass sie als politische Gegner der Nazis verfolgt wurden. Ihre Namen sind meist ungenannt, ihre Taten noch nicht erzählt.
Jüdische "Kämpfer für die Freiheit"
Unter den 13 Nazi-Gegnern und Gegnerinnen aus Karlsruhe, die in Frankreich Widerstand leisteten, stammen allein acht aus jüdischen Familien. Sie korrigieren das Bild jüdischer Menschen in der NS-Zeit als bloße Opfer, sie ließen sich nicht wie Lämmer zur Schlachtbank führen, sie haben sich gewehrt. Die Brüder Ferdinand (1921-2017) und Leopold (1920-1944) Kahn leben mit den Eltern seit 1929 in der Durlacher Allee 53, besuchen die Tullaschule sowie das Bismarck-Gymnasium und sind aktiv im Karlsruher Turn-Verein. 1933 verliert der Vater seinen Arbeitsplatz als Viehhändler und erhält Drohbriefe. Daraufhin flieht die Familie nach Frankreich. Als sie 1943 von der Polizei des Vichy-Regimes verhaftet werden sollten fliehen die Brüder und die Eltern schützt ein Arzt durch die Bescheinigung der Transportunfähigkeit. Im Herbst dieses Jahres schließen sich die Brüder im französischen Zentralmassiv bei Limoges der Résistance an. Aktiv bei den kommunistisch orientierten "Francs-Tireurs et Partisans" (FTPF), sprengen sie Brücken, Eisenbahngleise und Straßen, um Truppenbewegungen der Nazi-Wehrmacht zu be- und zu verhindern. Am 18. Juli 1944 wird Leopold bei einem Gefecht mit der Brigade Jesser, bestehend aus Truppen der Wehrmacht und der Waffen-SS, bei Saint Gilles-les-Forêts östlich von Limoges erschossen - vor den Augen seines Bruders Ferdinand. Sein Name steht auf einem Denkmal für Résistance-Kämpfer in Limoges und auf einer Stele am Ortsrand von St. Gilles-les-Forêts. Ferdinand Kahn bleibt nach Kriegsende mit den Eltern in Frankreich und wird nach seinem Tod 2017 als "Kämpfer für die Freiheit" geehrt.
Erich Marx (1906-1965) wird in Grötzingen geboren und besuchte das Humboldtgymnasium. Er ist vor 1933 Mitglied der jüdischen Gemeinde in Karlsruhe sowie des jüdischen Wanderbundes "Kameraden" und zugleich Kommunist und 1932 Leiter der "Antifaschistischen Aktion". Von März bis Mai 1933 sperren ihn die Nazis ohne Gerichtsurteil in "Schutzhaft" ins Gefängnis an der Riefstahlstraße. Wieder in Freiheit, flieht er nach Frankreich, wo er Ilse David heiratet. Nach der Teilbesetzung Frankreichs durch die Nazi-Wehrmacht flieht das Paar in den unbesetzten Süden des Landes. Nach dessen Besetzung durch die Nazis im November 1942 tauchen die Eheleute unter und erhalten neue Papiere von der Résistance. Im Sommer 1943 schließt sich Erich, nun Ernst Marquet, in Montauban der Résistance an und hilft, Flugblätter an deutsche Besatzungssoldaten zu verteilen. Außerdem ist er beteiligt bei der Herstellung von falschen Papieren für Flüchtende und Gefährdete. 1944 ist er Mitglied des CALPO (Comité Allemagne libre pour l'Ouest, dem Nationalkomitee "Freies Deutschland" für den Westen) in Montauban. Nach 1945 zieht die Familie in einen Ort im Nordwesten von Paris.
Die in Karlsruhe geborenen Brüder Fritz (1904-1997) und Walter (1903-1967) Strauss besuchen das Helmholtz-Gymnasium. Walter macht nach der Mittleren Reife eine kaufmännische Lehre, um dann in der Firma des Vaters schon 1930 Teilhaber zu werden. Er ist Mitglied des jüdischen Wanderbundes "Kameraden", seit 1925 engagiert in der SPD und im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gegen die Nazis. Zugleich ist er Redner des "Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens", der ab 1929/30 auch antifaschistische Aufklärungsarbeit leistet. Walter Strauss verlässt Deutschland Ende Juli 1933 und geht nach Paris, wo sein Freund Hans Marum bereits seit Ende April lebt. Hier heiraten er und Marianne Born und er gründet 1934 eine Firma. Fritz Strauss studiert 1923 bis 1928 Elektrotechnik in Karlsruhe und Berlin, wo er die Diplom-Prüfung ablegt. 1933 emigriert er nach Palästina und heiratet dort die aus Polen stammende Franziska, kehrt aber 1934 nach Karlsruhe zurück und arbeitet bei der AEG. 1937 emigriert auch er mit der Familie nach Paris.
Mit Kriegsbeginn wird Fritz Strauss wie sein Bruder Walter als "feindlicher Ausländer" in Frankreich interniert. Beide entschließen sich, mehr oder weniger gezwungen, in die Fremdenlegion einzutreten. Sie kommen nach Algerien und Marokko. Nach dem Waffenstillstand werden sie im Oktober 1940 aus der Legion entlassen. Danach leben sie mit ihren Familien einige Zeit in der unbesetzten Zone Frankreichs und danach illegal im Untergrund und werden in der Résistance aktiv, der sich die Ehefrau von Fritz ebenfalls anschließt. Fritz Strauss wandert mit seiner Familie 1946 in die USA aus, Walter Strauss bleibt dagegen in Frankreich.
Werner Nachmann (1925-1988) besucht ebenfalls das Helmholtz-Gymnasium. 1938 schicken ihn seine Eltern nach Paris, wo er ein jüdisches humanistisches Gymnasium besucht. 1939 fliehen auch die Eltern, die 1937 ihr Unternehmen verkaufen mussten, nach Frankreich. In Aix-en-Provence besucht ihr Sohn mit gefälschten Papieren ein Gymnasium. Ab November 1942 leben die Eltern illegal im Süden Frankreichs, Werner Nachmann schließt sich in Aix-en-Provence der Résistance an. Anfang April 1945 kehrt er als Oberleutnant der französischen Armee nach Karlsruhe zurück. Dass Werner Nachmann als Vorsitzender des Oberrates der Israeliten Badens und des Zentralrates der Juden in Deutschland schwerwiegende politische und finanzielle Schäden anrichtete, steht auf einem anderen Blatt.
Flüchtlinge werden Fluchthelferinnen
Edith Odenwald (1921-1997) ist in Karlsruhe geboren und besucht die höhere Schule. Als sie gerade 15 Jahre alt ist, beschließen ihre Eltern 1936 Karlsruhe zu verlassen, nachdem ihr Vater kurzzeitig im Konzentrationslager Dachau inhaftiert war. Edith muss sich von ihren Freundinnen im jüdischen Sportverein Maccabi verabschieden. In Neuilly bei Paris besucht sie wieder eine höhere Schule und schließt sich den jüdischen Pfadfindern Éclaireurs Israélites de France (EIF) an. Von April bis Juni 1940 werden sie, ihre Schwester Lore und ihre Eltern als "feindliche Ausländer" im Lager Gurs eingesperrt.
Nach 1941 arbeitet sie in der "Sixième" mit, der Jugendabteilung des Gesamtverbands der Juden in Frankreich (UGIF), einem geheimen Netzwerk von EIF und zionistischer Jugendgruppe (MJS). Mit neuen Papieren auf den Namen "Edith Oberlin", geboren in Obernai im Elsass, hält sie Kontakt zwischen den Gruppen und zu Organisationen wie der OSE (jüdisches Kinder-Hilfswerk) und der CIMADE (protestantische Frauen-Organisation). Sie arbeitet als Kinderpflegerin, hilft, Papiere für bedrohte Kinder zu fälschen, leitet eine provisorische Schule für sie auf einem Bauernhof und bringt sie an die Grenze zur Schweiz. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kameradinnen entgeht sie allen Razzien und Deportationen. Nach dem Krieg arbeitet sie für JOINT (Kürzel für "American Jewish Joint Distribution Committee"), eine Hilfsorganisation US-amerikanischer Juden für notleidende Juden vor allem in Europa.
Ebenfalls Mitglied der "Sixième" ist ab 1942 die 1920 in Karlsruhe geborene Ellen Hess. Sie lebt mit ihren Eltern in guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Wann die Familie nach Frankreich flieht, ist nicht bekannt. Erst 1942 finden sich wieder Spuren ihres Lebens: Im französischen Zentralmassiv organisiert sie, als "Estelle Hamelin" mit neuen Papieren ausgestattet, Verstecke und falsche Papiere für jüdische Kinder, um sie vor Razzien und drohender Deportation zu schützen. Sie unterhält Kontakte zu ihren Schützlingen, besorgt Geld für ihre Unterbringung, übermittelt Briefe und unterstützt sie moralisch. Das Netzwerk steht in Verbindung mit protestantischen Gemeinden in Le-Chambon-sur-Lignon und Umgebung, wo viele jüdische Kinder und Jugendliche versteckt und mit neuen Ausweispapieren ausgestattet werden, um ihre Flucht mithilfe von "Passeuren" in die Schweiz zu ermöglichen. Unter den so Geretteten sind auch Kinder aus Karlsruhe, die Geschwister Hanni und Leon-Albert Bär, die Geschwister Bertha und Leo Dreyfuss, Heinz Goldschmidt, Walter Moos und die Schwestern Hanna und Susanne Moses. Wann Ellen Hess sich mit Roger Climaud verheiratete, ist nicht herauszufinden, auch fehlen jegliche Angaben über ihren Lebensweg nach der Befreiung 1944/1945. Nach Karlsruhe ist sie nicht zurückgekehrt.
Rettungswege: Karlsruhe - Frankreich - Schweiz - Mexiko
In die Reihe der Fluchthelferinnen gehört auch die in Karlsruhe geborene Herta Field, geb. Vieser. Sie gelangt zusammen mit ihrem Mann Noel Field auf abenteuerlichen Wegen 1941 nach Südfrankreich (s. Blick in die Geschichte Nr. 115). Ab Frühjahr 1941 leiten die beiden, deren Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei verborgen bleibt, eine Hilfsorganisation des Unitarian Service Committee (USC) in Marseille. Dieses Komitee unterstützt vor allem Antifaschisten, die in Internierungslagern wie Gurs oder Le Vernet oder in der Illegalität leben müssen und denen die Auslieferung an die Nazis droht. Die Fields besorgen für sie Lebensmittel, Geld, neue Papiere und medizinische Versorgung. Etliche gelangen mit ihrer Hilfe nach Mexiko, so 1942 Hans Marum aus Karlsruhe, seine Frau Sophie und die Kinder Ludwig und Andrée. Herta Field sorgte im Juni 1941 dafür, dass die hochschwangere Sophie Marum in ein Heim der Quäker bei Marseille verlegt und mit Baby-Erstausstattung für die Tochter Andrée versorgt wird. Sie ist beteiligt an der Einrichtung von Kindergärten für im Lager Rivesaltes eingesperrte jüdische Kinder. Nach der Besetzung des südlichen Teils Frankreichs 1942 durch die Nazi-Wehrmacht fliehen die Fields in die Schweiz. Von Genf aus betreiben sie als USC-Büro eine "bürgerlich getarnte Rote Hilfe" - so Noel Field - und ermöglichen weiter Hunderten von Gefährdeten, unter ihnen viele Kommunisten, die Flucht aus Frankreich. Sie arbeiten mit der OSE zusammen, um jüdische Kinder, deren Eltern 1942 schon deportiert worden waren, in die Illegalität oder in die Schweiz zu retten, unter ihnen auch die Brüder Arnold und Paul Niedermann aus Karlsruhe.
Spanienfreiwillige und Résistance-Kämpfer
Josef Eckl und Emil Maisch sind in Karlsruhe geboren, beide von Beruf Schreiner und Mitglied der KPD (s. Blick in die Geschichte Nr. 111). Die Nazis sperren die beiden Antifaschisten 1933/34 unterschiedlich lange in verschiedene Konzentrationslager und Gefängnisse. Nach der Freilassung flieht Eckl in die Schweiz und arbeitet mit am Schmuggel von illegalen Schriften nach Deutschland. Maisch flieht nach der Freilassung 1935 nach Frankreich. 1936 gehen beide nach Spanien, um in den internationalen Brigaden gegen den von Hitler-Deutschland unterstützten Militärputschisten Franco zu kämpfen. 1939 müssen sie Spanien verlassen und werden in Frankreich interniert. Josef Eckl gelingt 1940 die Flucht aus einem Lager. Er schließt sich der Résistance an und ist Mitglied bei den FTPF mit dem Decknamen "Antonio" und den Forces Françaises de l'Intérieur im Gebiet Tarn und Garonne. Er wird Mitglied der kommunistischen Partei Frankreichs und des "Vereins früherer Freiwilliger im republikanischen Spanien". Der Militärkommandant der Nationalen Front (Zusammenschluss aller Résistance-Gruppen) bescheinigt 1945, dass er "in unseren Reihen tapfer gekämpft hat und der Sache des Widerstands Dienste leistete". Emil Maisch meldet sich in Frankreich zur Fremdenlegion, um bewaffnet gegen die Nazi-Wehrmacht kämpfen zu können. Nach dem Einsatz in Nordafrika wird er demobilisiert, schließt sich 1943 der Résistance an und kämpft bei den FTPF. Der Kommunist Ernst Locke aus Karlsruhe-Grünwinkel flieht nach einer Haftstrafe im November 1933 in die Schweiz, kämpft wie Josef Eckl und Emil Maisch ab 1936 in Spanien und schließt sich nach 1940 der Résistance in Frankreich an.
Diese Spanienfreiwilligen und Résistance-Kämpfer kehren 1945 nach Karlsruhe zurück. Johann Heinz (1905-1944) war dies nicht mehr möglich: Er verlässt 1937 seine Heimat, 1939 schreibt er seiner Mutter, er sei in Spanien gewesen und halte sich nun in Frankreich auf. Nach der Befreiung erhält die Mutter die Nachricht, ihr Sohn sei Mitglied der Résistance gewesen und 1944 in den Cevennen von der Wehrmacht erschossen worden. Wahrscheinlich ist er identisch mit "Karl Heintz", der als Mitglied der Résistance-Gruppe Bir-Hakeim am 20. Mai 1944 in La Parade im Zentralmassiv von der Wehrmacht ermordet wurde und dessen Name dort auf einer Erinnerungsstele verzeichnet ist.